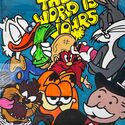Sie suchen eine bestimmte Ausstellung? Dann geben Sie einen Suchbegriff, Zeitraum, Ort oder ein Veranstaltungshaus ein und wir finden die passende Ausstellung für Sie.
Aktuelle Kunstausstellungen in Bonn finden
Kunstmuseum Bonn
Malerei, Grafik & Zeichnung, Bildhauerei, Fotografie, MedienFriedrich-Ebert-Allee 2 (Museumsmeile)
53113 Bonn
| Tel | +49 (0) 228 / 77 62 60 |
| Fax | +49 (0) 228 / 77 62 20 |
kunstmuseum@bonn.de
Beschreibung
Das Kunstmuseum Bonn gehört zu den großen, bundesweit beachteten Museen für Gegenwartskunst. Sein 1992 eröffneter, von dem Berliner Architekten Axel Schultes entworfener Neubau zählt deutschlandweit zu den wichtigsten Museumsbauten der letzten Jahrzehnte. Die Sammlung des Hauses umfasst rund 7.500 Werke mit einem zentralen Werkkonvolut zu August Macke und der Kunst der Rheinischen Expressionisten sowie zur deutschen Kunst nach 1945. Ferner gibt es eine Grafische Sammlung, einen großen Bestand von Beuys-Multiples mit mehreren Hundert Objekten, Werke von Max Ernst, eine Kollektion von Videokunst der 1960er- und 1970er-Jahre sowie eine Sammlung künstlerischer Fotografie.
Öffnungszeiten
| Montag | Geschlossen | |||||
| Dienstag | 11:00:00 | - | 18:00:00 | |||
| Mittwoch | 11:00:00 | - | 21:00:00 | |||
| Donnerstag | 11:00:00 | - | 18:00:00 | |||
| Freitag | 11:00:00 | - | 18:00:00 | |||
| Samstag | 11:00:00 | - | 18:00:00 | |||
| Sonntag | 11:00:00 | - | 18:00:00 | |||
Besondere Öffnungszeiten
Die Bibliothek ist donnerstags von 13.30 - 16.00 Uhr geöffnet. Geschlossen am 24.12., an Weiberfastnacht und am Rosenmontag.
Eintrittskosten
7€, erm. 3,50 €. Gruppen ab 10 Personen 5,60 €, erm. 2,80 € (pro Pers.). Familienkarte 14 €. Jahreskarte 40 €, erm. 20 €. Freier Eintritt für Kinder bis 12 J., Schulklassen, ICOM, Mitglieder des Freundeskreises, Stifter und Mäzene.
Gruppenführungen bis max. 30 Personen ab 50 €. Führungen für Kinder und Jugendliche ab 15 Personen ab 2,50 € (pro Pers.).
Zufällige Veranstaltungen / Ausstellungen der Ausstellers
Sie sind redaktionell verantwortlich für Kunstmuseum Bonn oder möchten Ausstellungen auf kunstaustellungen.de inserieren? Dann nehmen Sie Kontakt zu uns auf oder melden sich direkt an.